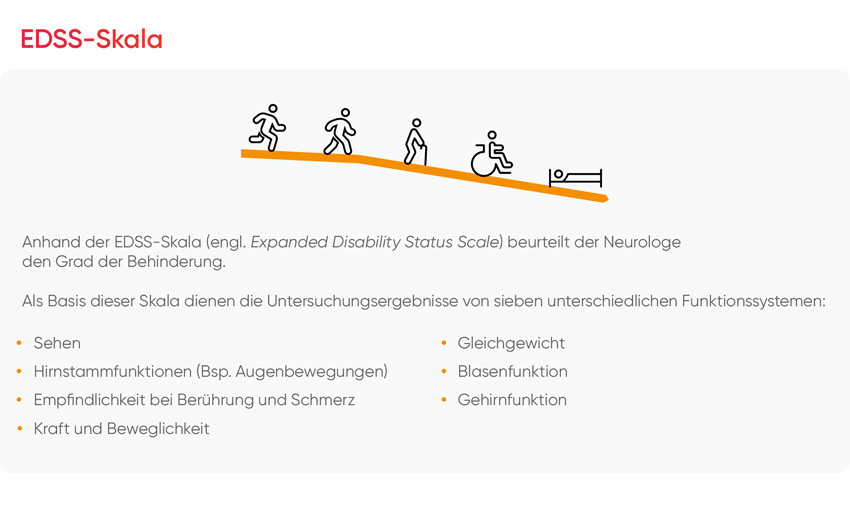Neben der klassischen NEDA-3-Definition gibt es mittlerweile auch die erweiterte Variante NEDA-4. Hierbei wird zusätzlich die Veränderung des Hirnvolumens (Hirnatrophie) berücksichtigt, ein subtiler, aber bedeutsamer Indikator für neurodegenerative Prozesse, die klinisch oft zunächst unbemerkt verlaufen.
Studien legen nahe, dass eine beschleunigte Hirnatrophie (Verlust von Gehirngewebe) mit einem ungünstigen Langzeitverlauf bei MS einhergehen kann. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass Hirnatrophie unterschiedliche Ursachen haben kann – etwa neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Demenz, aber auch natürliche Alterungsprozesse und Infektionen.
Durch die Integration dieses vierten Kriteriums ergibt sich also ein noch umfassenderes Bild der Krankheitsaktivität, das potenziell auch stille, also symptomfreie Veränderungen abbildet.